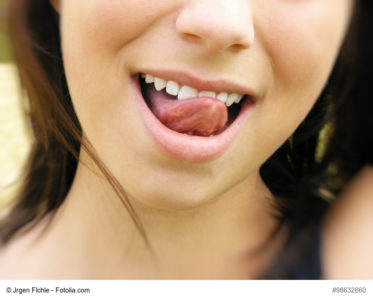Tag der gesunden Ernährung 2016: "Onkologie"
Auch 2016 veranstaltet der Verband für Ernährung und Diätetik e.V. (VFED) den „Tag der gesunden Ernährung“ – bereits zum 19. Mal. „Mit diesem Aktionstag machen wir die Bevölkerung in Deutschland auf die Wichtigkeit der gesunden Ernährung aufmerksam“, so Margret Morlo vom VFED. Bundesweit finden jährlich mehr als 2000 Aktionen zum Tag der gesunden Ernährung statt. Am 19. Tag der gesunden Ernährung im März 2016 lautet das Thema „Onkologie“.
Die Diagnose „Krebs“ ist für die meisten Betroffenen zunächst mit Ängsten verbunden. Besonders Gedanken an mögliche Therapienebenwirkungen, Schmerzen, Leiden und das Einbüßen von Lebensqualität kommen auf.
Dabeisein macht Sinn
Der Faktor Ernährung spielt sowohl bei der Entstehung als auch während und nach einer Tumortherapie eine wichtige Rolle. Eine gesunde Lebensweise mit der richtigen Kost kann ungewollte Nebenwirkungen mildern und sich positiv auf das allgemeine Wohlbefinden auswirken. Die unterstützende Ernährungstherapie ist daher ein wichtiges Thema in der Ernährungsberatung. Mit dem Tag der gesunden Ernährung möchte der VFED die Bevölkerung für dieses bedeutende Thema sensibilisieren. Der VFED ruft am Tag der gesunden Ernährung zu umfangreichen Aktionen in Krankenhäusern und Kliniken, Arztpraxen, Altenheimen, Apotheken und Bildungseinrichtungen auf: „Seien auch Sie dabei! Nutzen Sie den Tag der gesunden Ernährung, um sich und Ihr Aufgabenfeld in der Bevölkerung bekannter zu machen und um neue Kontakte zu knüpfen.“
So können Sie als Ernährungsfachkraft mitmachen
Planen Sie eine Veranstaltung nach Ihren Möglichkeiten, persönlichen Stärken und Vorlieben. Mögliche Aktionen sind zum Beispiel ein Vortrag (wird vom VFED e.V. erstellt) und Informationstisch in einem Krankenhaus oder einer Klinik, ein Kochkurs bei der Volkshochschule oder einer anderen öffentlichen Einrichtung. Möglich ist ein Aktionstag in einer Apotheke, einem Geschäft oder der Bücherei, Verkostungen, Interviews und Seminare. Der eigenen Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Jede(r) Interessierte kann seine Ideen umsetzen. Sie können eine Aktion allein oder mit Kolleg(inn)en anbieten. Sie können sich Kooperationspartner (Firmen, Vereine) suchen,die Sie finanziell, mit Produkten oder Räumlichkeiten unterstützen. Für weitere Ideen besuchen Sie die Internetseite des VFED; unter https://www.vfed.de/de/archiv_ finden Sie Bilder der vorherigen Tage der gesunden Ernährung.
Tag der gesunden Ernährung – so unterstützt der VFED
Der VFED stellt eigens für den Anlass ein spezielles Aktionspaket zusammen, das Teilnehmern die Ausgestaltung des Aktionstages vereinfacht. Mit Hilfe der enthaltenen Materialien können Sie für Ihre Aktion werben, Ihr Schaufenster oder Ihren Stand dekorieren und sich selbst fachlich vorbereiten. Außerdem erhalten Sie Informationen zur Anforderung von Broschüren und anderen Materialien für Ihre Teilnehmer. Unter anderem enthält das Aktionspaket:
● 1 VFEDaktuell Fachmagazin „Onkologie“ (Neuauflage 2016, circa 100 Seiten) ● 50 Leporellos zum Thema „Onkologie – Mit Schwerpunkt Prävention“ ● 2 Plakate „Tag der gesunden Ernährung“ für die eigene Werbung ● 1 Broschüre „Gesund genießen bei erhöhten Cholesterin- und Triglyceridwerten“ ● 1 Broschüre „Lecker und ausgewogen mit dem VFED-Ernährungsdreieck“ ● 1 Plakat BMI für Erwachsene ● 1 Plakat BMI für Senioren ● 1 Plakat „Ernährungsdreieck“ ● 1 Beratungsunterlage VFED Ess- und Aktivtagebuch ● 1 Poster Bewegungsprogramm für jedes Alter, DIN A4 ● 10 Aufkleber „Ernährungsdreieck des VFED“ ● 1 VFED-Kugelschreiber ● Bestellmöglichkeit für einen Folienvortrag zum Thema (Text und Folien). (Die Folien werden im Aktionspaket präsentiert und der Preis genannt, bei Bestellung wird der Foliensatz separat in Rechnung gestellt.) ● Bestellschein für die kostenlose Anforderung von Broschüren und Give-aways (z. B. Probepackungen) von unterschiedlichen Firmen.
Das Aktionspaket ist für 20,- EUR, zuzüglich 2,00 EUR für Verpackung und Porto, erhältlich und wird im Februar2016 verschickt. Zusätzlich übernimmt der VFED die Koordination des Aktionstages, informiert die Medien und gibt Tipps für Ihre Pressearbeit. In über 250 Städten und Gemeinden werden am Tag der gesunden Ernährung in jedem Jahr über 2000 Aktionen durchgeführt.
Mehr Informationen erhalten Interessierte über die VFED-Geschäftsstelle bei Frau Hedwig Hugot (Geschäftsführerin, 0241-507300, info@vfed.de)oder Frau Margret Morlo (Leitung Tag der gesunden Ernährung, Kollegenhotline, mmorlo@vfed.de). Mehr Infos auch auf der Website, wo ein Informations- und Bestellschein für das Aktionspaket heruntergeladen werden kann.
Quelle VFED